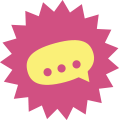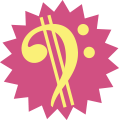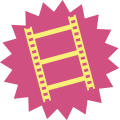Zunächst einmal eine kleine Geschichte. Es ist eine Geschichte von hohem Stellenwert in der Kleingärtnerei sowie in der Käsetranchenberechnung, für alle Leute von großem Nutzen, besonders für die Kunden, den diese kaufen die exakt berechneten Käsetranchen dann ja schließlich. Sie meinen, Sie wollen lieber über Zwerglilienzüchtung lesen? Nun, dazu später etwas.
Zurück zu den Käsetranchen. Hierbei lautet das wichtigste Gebot: Einfallswinkel gleich Ausfallwinkel, sonst könnte es passieren, daß man erwischt wird, weil keine dimensionale Verschiebung mehr vorliegt, und man somit sofort als verdächtig auffällt. Bestenfalls arbeiten Sie ohnehin im Untergrund. Zweiter wichtiger zu beachtender Punkt ist Ihre Wahl des Tranchierwerkzeugs. Die besten Steuerspartips lauten: verdienen Sie nichts, geben Sie all Ihr Geld so schnell wie möglich aus und vor allem aber, und dazu möchte ich jedem einmal empfohlen haben, wäre die Sache mit dem Standort ein bedeutender Faktor. Bewährt haben sich auf diesem Gebiet das ovale ungerillte Tranchierbrett aus Holz. Hier können Sie dann mit Hilfe Ihres aus den Steuereinsparungen finanzierten und sorgsam ausgewählten Tranchierwerkzeugs, wobei ich Ihnen von der Cuisinex Käsetranchierkettensäge abgeraten haben möchte, da der Käseverschleiß hier doch recht hoch ist, die perfekten Käsetranchen herstellen.
Sie haben nun Tranchierunterlage und -werkzeug zwar bestimmt, doch fehlt aber noch der Käse, den es zu tranchieren gilt. Nehmen Sie vorzugsweise einen gelben oder weißen Kuhkäse, auch geeignet ist sehr reifer, harter Ziegenkäse. Einen Anreiz für Käsetranchierer im fortgeschrittenen Stadium stellt sicherlich auch Schimmel- und Nußkäse dar, welchen ich Ihnen im Augenblick jedoch noch nicht empfehlen würde. Wichtig!!! Beachten Sie auf jeden Fall das Verfallsdatum im Katalog!!! Es kommt oft vor, daß Händler versuchen, Ihnen irgendeinen angeblich fast neuen Käse anzudrehen, der tatsächlich bereits mehrere hundert Kilometer über dem Limit gefahren worden ist.
Wenn Sie dann alle Zutaten für ein vergnügliches Käsetranchieren beisammen haben, vergessen Sie auf gar keinen Fall das Wichtigste, den Stimmungsmacher nämlich. Grundsätzlich gilt als Stimmungsmacher alles, was Stimmung macht; Sie können also z.B. ein Konzert besuchen, zu einem Fußballspiel gehen oder nach Hokkaido zum Wandern fahren. Im Grunde macht es gar keinen Unterschied, solange Sie nur Spaß an Ihrer Beschäftigung haben. Wenn Sie dann in der richtigen Stimmung sind, denken Sie nach. Dies ist, ob Sie es glauben oder nicht, der allerwichtigste Schritt beim Käsetranchieren. Denn Sie sollten sich, noch bevor Sie das Messer ansetzen, ein weiteres Mal gründlich überlegen, wie weit Sie gehen können, indem Sie die alleinige Verantwortung sich überlassen. Ein Gespräch unter vier Augen bei Ihrer Bank sollten Sie auf keinen Fall auslassen.
Sind sie sich Ihrer Sache dann endlich sicher geworden, drücken Sie kräftig zu, aber achten Sie darauf, dabei stets in der Vertikalen zu bleiben. Anfangs können Sie an Problemstellen noch die Zickzackmethode verwenden, da Sie sich dies im Laufe Ihrer Karriere ganz von allein abgewöhnen werden; arbeiten Sie jedoch von vornherein grundsätzlich nur mit einer Hand, da dies Ihre ganze Professionalität ausmachen wird. Ist der Käse dann erst einmal tranchiert, nehmen Sie einen neuen und beginnen von vorne. Die Verwendung von Eiern steht Ihnen je nach Geschmack frei, sollte jedoch zumindest einmal ausprobiert werden, da dies mit Sicherheit einen der Höhepunkte beim Käsetranchieren darstellt. Wer noch extremer einsteigen möchte, dem kann der Einsatz von Basilikum, Estragon oder Oregano empfohlen werden.
Abschließend bliebe noch anzumerken, daß eine gewisse »Coolness« bei diesem Akt sicherlich von großem Vorteil sein wird, vor allem dann, wenn Kunden in den Laden kommen - seien Sie immer beschäftigt, das wirkt sich positiv auf die Entfernung der Mundwinkel zueinander aus.
Was das mit Zwerglilienzüchtung zu tun hat, fragen Sie? Nun, das ist schnell gesagt: Zwerglilienzüchtung funktioniert genauso, abgesehen davon, daß man hier statt einem Tranchierbrett einen Blumentopf verwendet.
Dieser Artikel ist ALT. Er erschien zuletzt in der Schülerzeitung des Parler Gymnasiums 1998.