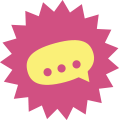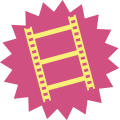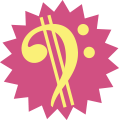Eichhörnchenstreet. Das sind sehr putzige Tiere, aber in Berlin-Kreuzberg sind sie nicht arg verbreitet. Stattdessen die Bettlerin mit ihrem Schoß auf dem Kind, was schockierend wäre oder zumindest eigenartig, glücklicherweise aber genau andersherum ist. Normale Welt.
Wie ich die Straße hinabgehe, kommt mir die zweite Schicht entgegen, man sollte nicht meinen, Bettelei sei Faulheit und Schmarotzertum. Das ist nicht leicht, den ganzen Tag im Abgas zu sitzen. Unten am Boden, an der Bordsteinkante, wo der Ozongehalt am größten ist, völlig im Widerspruch zum Bettlergehalt. Ein Knochenjob für ein paar Kröten.
Ja sicher haben Kröten ein Skelett, selbstverfreilich, nur ist das viel kleiner als beispielsweise beim Menschen, weshalb das oft verwechselt wird.
Kröten sind in Berlin-Kreuzberg auch nicht so viele unterwegs. Zumindest sind mir während meiner zahlreichen Besuche niemals welche aufgefallen, vielleicht schaue ich einfach nicht gründlich genug hin. Zumindest in gepflegter Glaskastenhaltung ist von einer gewissen Populationsmenge auszugehen, immer vorausgesetzt, die biologischen Führer lassen sich darauf ein, die Summe der Einzelhaltungen zu einem "engeren Gebiet" zu erklären. Zumindest beschreibt es der Duden so. Aber wie jeder politische Exkurs endet auch die Diskussion um Kröten in der Innenstadt in feingliedrig überladenem und dabei schwerfällig gewordenem Geplänkel. Sehen wir es doch ein: Kröten gehören in die Außenstadt. Strich unter dieser Rechnung.
These: auch komplexe Probleme verdienen einfache Lösungen. "Reich mir den Prosektor" schimpfte kleinlaut Professor Name, ein Etymoliker übelster Prägung, der seine Kollegen in Stetigkeit mit Fachbegriffen wie antizipando und Barbecue nervte. Es war eine Party, auf der ihn niemand haben wollte, weshalb auch vergessen wurde, ihm eine Einladung zu schicken. Aber Wände haben nun mal Ohren und der Professor einen Hausschlüssel. Es war ein bißchen wie früher. Erfolgreich hatte er sich damals gegen die Knaus-Ogino-Methode durchgesetzt.
Neben Schaumwein und Fischbrötchen gab es natürlich auch noch was vom Fach an diesem Spätnachmittag. Aufwendige Projektionstechnik sorgte für ästhetische Freiheit in Form von Schaubildern auf Leinwand.
"PATCHWORK ist eine legitime Methode zur Informationsaufbereitung in einem perversiven Stressorenkontext. Deus ex machina!"
Aber auch eine hochspezialisierte Maschine macht nicht alles sofort und auf einmal, und sie prozudiert Fehler. So hatte Professor Name noch alle Zeit seiner eigenen kleinen friedfertigen Welt, mit Hilfe des Rückwandprojektors und dem Fischbrötchenstand lustvolle Schattenspiele zu veranstalten, während er sich hinter der Leinwand vor der Abscheu seiner Kollegen in Sicherheit wähnte. Vorne lauschten die Deletierten aus Kultur, Presse und Bildung gebannt einem Gastvortrag über diverse Dinge.
Ich bin in einen Comicladen gegangen. Diesen Satz möchte ich gern so stehen lassen. Wenn das Leben reiner Selbstzweck ist – besser: wenn man sich damit abgefunden hat, daß das Leben reiner Selbstzweck ist, muß man vernünftigerweise Geschichten aus dem Leben gleichermaßen als Selbstzweck betrachten und hinnehmen. Und wenn die ganze Geschichte Selbstzweck ist, ist dem einzelnen Satz innerhalb dieser Geschichte das gleiche einzuräumen. Ja freilich, ich hör sie schon wieder rufen, die Literaten, mit ihren Einsprüchen und Widersprüchen! Literatur als Selbstzweck, geht's eigentlich noch? Wir nähren hier den kulturellen Hunger unserer Mitmenschen, oder besser Bürger, ohne den wir uns gar nicht Zivilisation schimpfen dürften! Ich verweise an dieser Stelle auf meinen verzwickt-verzweckten Satz Eins, Absatz Neun.
Es darf jetzt nachgedacht werden. Ich will keine tiefschürfende Aussage treffen, aber dennoch: wer an dieser Stelle nicht verstanden hat, ist dumm. Und ich möglicherweise ein schlechter Literat, weil ich nicht anders zu provozieren weiß, aber dieses Urteil dürfen andere fällen, in ihren eigenen kleinen friedfertigen Welten.
Ich verlasse also diesen Comicladen wieder (nachdem ich mir darin schön Bildchen angeguckt habe) und nehme den gleichen Weg zurück zur U-Bahn. Dabei fällt mir auf, wie schnell doch meine ursprünglichen Gedanken zum Bettelwesen, aus denen ich gern eine eigenständige Geschichte geschrieben hätte, verflogen waren. Bettlerin mit Kind scheint zudem den Standort gewechselt zu haben. Nahtlos schließen an solche Empirismen Konsequenzen an. Was beim Patchwork nicht fehlen darf, ist ein wiederkehrendes Motiv. Besser mehrere, darunter ein offensichtliches Leitmotiv für die Oberflächlichen und ein oder zwei subtilere, die sich erst bei kluger Analyse ergeben. Gut sind auch zwei konkurrierende Leitmotive, die ein drittes Motiv cachieren, indem sie den Betrachter vor die langwierige, verwirrende Aufgabe stellen, unter diesen beiden den intendierten Schwerpunkt auszumachen. Auf der vierten Ebene, oder bei wieviel auch immer ich grade bin, kommt dann eine Aussage ins Spiel, die alle Motive umgibt, gern auch, indem sie gerade in der Konkurrenz dieser Motive zu finden ist. Im nächsten – und finalen – Schritt verliert sich das Werk dann so sehr in seinem eigenen Selbstzweck, daß es für den Betrachter unerträglich wird, für den klugen, weil er die Nichtigkeit des Gezeigten erkennt, für den dummen, weil er glaubt, von einem zu hohen intellektuellen Niveau stehengelassen worden zu sein, oder, häufiger, bedingt durch seine, des Werks, Zielgruppe, weil er, der Betrachter, glaubt, es, das Werk, verstanden zu haben. Glaubt, wohlgemerkt.
Am Kottbusser Tor sind beim Umsteigen von U8 auf U1 nicht unerhebliche Höhenunterschiede zu überwinden.