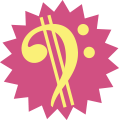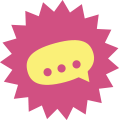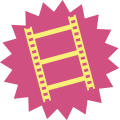Eigentlich will jeder ein Rocker sein. Egal, was die Studioplatte sagt - immer etwas lauter und aufregender muß es sein. Auch die leicht verkopften PUBLIC SERVICE BROADCASTING fügen sich dem Schema. Ab und zu holen sie dazu das Banjo heraus. Sie sind zu dritt; das sind deutlich weniger Menschen als Instrumente. Loopmaschine und Laptop springen ein.
Die Spracheinschübe aus BBC-Archiven, das Markenzeichen der Band, kommen mal live auf Tastendruck, mal titelweise vorprogrammiert, so wie das Bild zum Ton. Ein PSB Konzert hat ein Konzept; man ist quasi auf einer Kulturveranstaltung, nicht so wie bei anderen Bands, die als Rock-und-Roll-Anarchisten nur die Zerstörung gesellschaftlicher Tugend zum Ziel haben und nächtens Satan preisen. Nein, diese Gruppe sind brave Jungs im Sakko, dazu wahlweise Krawatte oder Fliege, die einfach Spaß an der Freude haben. Wenn dabei mal einer einen Hüpfer macht, so hat der Übermut noch Unschuld.
Auf der Leinwand visualisieren sich derweil jene Geschichten vom Krieg, der Raumfahrt und dem Farbfernsehen, die man sonst nur zu hören bekommt. Und noch ein Gimmick: Keiner spricht. Der Publikumskontakt kommt ebenfalls vom Band bzw. dessen neumodischen elektronischen Äquivalent. Die Ansagen sind eingesprochen, auf alt frisiert und mit humoristischem Timing abgespielt.
Ansonsten ist alles wie immer. Man will Rocker sein und rockt, immer etwas lauter und aufregender als auf der Platte. Die Überraschung ist, daß die braven Jungs auch abgehen können.