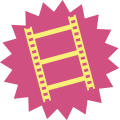Amnesie nach dem Unfall. Ein Mann (Tom Sturridge) erwacht aus dem Koma, kurz darauf hat sein Anwalt achteinhalb Millionen Pfund Schmerzens- und Schweigegeld für ihn ausgehandelt. Tom überlegt kurz, dann unterschreibt er. An das, worüber er schweigen soll, kann er sich ohnehin nicht erinnern. Kein schlechter Deal.
Doch dann sind da die seltsamen Rückblenden, Fragmente aus Bildern, Klängen und Gerüchen, schwer zuzuordnen, Bedeutung unklar, ebenso wie die Tatsache, daß Tom einige Dinge zu wissen und wiederzuerkennen scheint, die keiner sonst bestätigen kann. Die maximale Verwirrung liegt beim Zuschauer, der weder die Leute kennt, mit denen Tom angeblich bekannt ist, noch substanzielle Hinweise auf dessen Vergangenheit bekommt. Die Obsession des Protagonisten, sich aus allem einen Reim zu machen, nimmt derweil bizarre Ausmaße an: Er kauft ein mehrgeschossiges Stadthaus und heuert einen Manager namens Naz (Arsher Ali) plus Crew an, um darin tagein, tagaus Szenen aus seinem vernebelten Hirn nachzustellen in der Hoffnung, seiner verlorenen Vergangenheit damit näherzukommen.
Schnell wird aus dem einstigen Mystery Plot ein skurriler Film im Film. Tom, der Regisseur, erweist sich als skrupelloser Perfektionist, dessen bloße Rollenbeschreibungen an seine Schauspieler schmunzelerregend überzogen wirken, während Naz ihm als ausführender Produzent jeden Wunsch erfüllt. Der Produktionsaufwand steigt und steigt, und bald fragt man sich, wieviel achteinhalb Millionen Pfund nochmal genau wert sind.
Es ist diese Inszenierung einer Inszenierung, die REMAINDER seine Originalität verleiht und die ansonsten nicht so ungewöhnliche Handlung trägt. Das Regiedebüt von Omer Fast verweigert letztlich eine klare, chrono- und logisch nachvollziehbare Erzählung zugunsten eines verschachtelten Kommentars über den filmischen Produktionsprozeß selbst. Eine Wertung desselben fehlt jedoch ebenso wie jede schlüssige Aussage, die eine Geschichte über Erinnerung mit sich bringen könnte.
Am Ende weiß man nicht so recht, ob der Koffer voller Geld oder alles nur ein Traum war. In seiner minimalistischen Auseinandersetzung mit dem eigentlichen Anstoßpunkt der Handlung zugunsten seines abstrakteren metanarrativen Überbaus lädt REMAINDER aber kaum zu wilden, nachhaltigen Spekulationen über die Bedeutung von Allem ein und wird nach einmaliger, wenngleich unterhaltsamer Sichtung wohl alsbald.... vergessen.