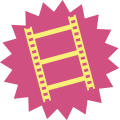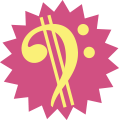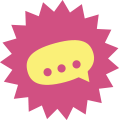Inga Yuzhina (Yuliya Aug) ist alleinerziehende Mutter und hat ein Problem. Ihr Sohn Veniamin (Pyotr Skvortsov) ist nicht nur Opfer einer slavischen Konsonantenverschiebung, er spinnt auch noch. Das ist zunächst nicht weiter ungewöhnlich, er ist in der Pubertät. Da spinnt man halt mal. Und die Eröffnungsszene sieht zunächst auch aus wie ein ganz normaler Familienstreit - Venia war seit Wochen nicht im Schwimmunterricht und will eine Entschuldigung von Mamuschka. Man könnte doch was von "aus religiösen Gründen" schreiben.
Leider entpuppt sich das als nicht nur einfach so daher geredet und Venia fängt an, mit Überzeugung und heiliger Wut aus der Bibel zu zitieren. Und das kreuz und quer, meist Verse über Verbote, Unzucht und des Herrngotts Faible für sadistische Strafen - die entsprechenden Bibelpassagen werden eingeblendet, man kann also mitlesen. Vorausgesetzt, man kann sehr schnell lateinische Zahlen entziffern.
Zunächst entfremdet Venias religiöses Erwachen ihn von seinen Mitmenschen, insbesondere Klassenkameraden und Lehrerschaft (größtenteils ältere Frauen, die noch in der Resignation des Spätsowjetregimes hängengeblieben scheinen und lediglich die Portraits und Fahnen ausgetauscht haben). Lediglich Grigoriy (Aleksandr Gorchilin), der wegen einer kleineren körperlichen Behinderung ausgegrenzt und gehänselt wird, läßt sich auf Venia ein und versichert ihm, seinen Glauben zu teilen. Was tut man halt nicht, um von irgendjemandem akzeptiert zu werden. THE STUDENT ((M)uchenik) basiert auf einem Theaterstück, Schauplätze und Besetzung sind entsprechend überschaubar. Das ist nicht schlimm, es bleibt Zeit die Charaktere zu erörtern und auch in den zunächst unsympathischsten Figuren ein Stück Menschlichkeit aufzuzeigen.
Allein Venia selbst entzieht sich größtenteils des Mitgefühls der Zuschauer - es gibt zwar Andeutungen bezüglich eines schwierigen Verhältnisses mit dem geschiedenen Vater, aber in erster Linie wird er als psychisch gestört und/oder unnachgiebig fanatisch charakterisiert. Sympathieträger dürfte neben der armen Sau Grigoriy für die meisten die von Viktoriya Isakova wunderbar renitent und überzeugt gespielte Biologielehrerin Elena Krasnova sein, die gewissermaßen als Stellvertreter für den rational wissenschaftlichen Kinoafficiando fungiert - in Anlehnung an den wunderbar vielseitigen englischen Begriff »Proxy« sei hier das Wort »Proxe« geprägt.
Elena läßt sich die rückständigen und unwissenschaftlichen Tiraden des Tunichtguts nicht gefallen und tut alles, um ihn als verblendet bloßzustellen. Paradoxerweise aber macht sie damit alles nur noch schlimmer. Die Rektorin und ihre treue Knechtin empören sich zwar über den Jungen, dann aber auch über die aus ihrer Sicht übertrieben progressiven Lehrmethoden Elenas. Und außerdem schlummert in den Damen auch immer noch ein Rest christlicher Prägung - was in der Bibel steht kann ja nicht ganz falsch sein! Also werden plötzlich die Mädchen der Klasse zu Badeanzug statt Bikini gezwungen, und warum sollte man neben der Evolution nicht auch die Schöpfungsgeschichte lehren? Und irgendwann fällt es leicht, eine Metapher für die vehemente Fortschrittsverweigerung von Konservativen und Fanatikern zu erkennen, die mit Lautstärke und Überzeugung oft mehr bewirken als Menschen mit Ratio und modernem Ethikverständnis.
Es ließe sich noch mehr sagen, aber es ist hoffentlich schon klar geworden, daß THE STUDENT faszinierend genug für eine klare Empfehlung ist. Die Russen wissen halt, wie man Wut, Verzweiflung und andere billige Psychoschlagwörter in den verschiedensten Medien gut rüberbringt. Sie wollen uns quasi fertigmachen, indem sie uns die Abgründe des Seelensumpfs vorspiegeln und wasweißich. Dazu trägt die fantastische Besetzung ebenso bei wie die schlaue Kameraführung, die gerne sehr nah an Geschehen und Gesichter rangeht.
Wer die Gelegenheit hat, Kirill Serebrennikovs kinematisches Drittlingswerk THE STUDENT zu sehen, sollte sich schämen, wenn sie ungenutzt bleibt. Viel Tiefsinn und schwere Kost wird durch grotesk-witzige Dialoge aufgefrischt, es gibt also zu denken und zu lachen, und am Schluß wird kräftig genagelt. Was will man mehr?