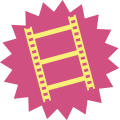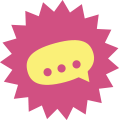Den Waschtag gibt es nicht mehr. Schuld sind die Waschmaschinen. Wie praktisch, einmal mehr ein persönlichkeitsloses Ding beschuldigen zu können. Und von Schuld muß alle Rede sein: Als in den 50er Jahren (19xx) die Waschmaschinen ihren flächendeckenden Einzug in deutsche Haushalte begannen, war von Frauenbewegerseiten schnell das Bild einer neuen, ungeahnt schamlosen Unterjochung der Frau im Haushalt gemalt, da das häufigere Wäschewaschen mit der Waschmaschine ja in der Wochennettozeit länger dauere als das einmalige Waschen am Waschtag. Und weil Waschen Frauenarbeit war (und ist).
Das ist natürlich Quatsch, denn schließlich wurde die Waschmaschine ja gar nicht für den Haushalt, sondern für die Textilindustrie entwickelt. Und lag preislich über dem durchschnittlichen Monatseinkommen. Selbst schuld, wer versuchte, so ein Gerät unter den Weihnachtsbaum zu zwängen.
In Somalia ist Frauen der Verzehr von Kamelhoden und -Herzen untersagt.
Wie dem auch sei, heutzutage stellt sich kaum noch jemand die Waschmaschine in die Küche - da ist ohnehin immer weniger Platz, wenngleich die Küchen seit dem Frankfurter Entwurf zunächst über den Umweg der DIN 18022 (»Küche und Bad im Wohnungsbau«, 1957) bis zur Kochinsel immer größer wurden; schließlich gibt es ja auch immer mehr unterzubringen.
Um nun den Widerspruch aufzulösen, daß Kochen zwar im konservativen Haushaltssystem vorwiegend Frauensache ist, es Frauen aber gleichzeitig auch in diesem Bereich nur selten an die Spitze internationalen Renommées schaffen, müssen wir Dinge tun.
Bereits an dieser Stelle droht der Artikel, sich in sinnleerem Geplänkel zu verlieren. Was hat Janus damit zu tun?
Während im dunklen Mittelalter der Begriff »Hausfrau« noch in der Bedeutung von »Hausvorsteherin« stand, wurde dieser im Zuge der Rationalisierung (»Vernünftigung«) von Technik, Haushalt, Sprache, Wertesystem und Allgemeinheit während des 19. Jahrhunderts zum Schlüsselwort weiblicher Tugenden im bürgerlichen Weltbild, welches bekanntlich auch in der Mitte des 20. Jahrhunderts noch anwährte, dessen wir im heutigen Zeitalter (10. April 2009) jedoch glücklicherweise gänzlich befreit sind.
Die Mutter trägt die von ihr liebevoll zubereitete Suppe auf, Kinder und Ehemann sitzen erwartungsvoll am Tisch. Das von der Mutter oder Ehefrau zubereitete Essen symbolisiert die Liebe als Zeichen der Fürsorge und Sorge für und um und umsorgt die Familienangehörigen. Auch heute haben wir immer noch ganz bestimmte Erwartungen an eine warme (Familien-)Mahlzeit: Suppe, Fleisch, Gemüse, Kartoffeln und Nachtisch, frisch zubereitet und auf einer Arbeitshöhe von 85cm mit Liebe gekocht.
Weitere Forderungen der emanzipativen 1950/60er Jahre umfaßten einen Abstand der Arbeitsfläche zur Türleibung von 10 bis 20cm, eine Brüstungshöhe der Fenster von mindestens 125cm wegen der davorliegenden Arbeitsflächen, Topfschrank in der Nähe des geteilten Herdes (Kochmulde und Ofen), Abzug über dem Herd, verkachelte Wände auf der Herd-Spüle-Seite, warme, rutschfeste und pflegeleichte Böden, sowie einen Kühlschrank, der nicht am Fenster stand, sondern in Türnähe.
Danach kam es Schlag auf Schlag und knüppeldick.
Im Fernsehen wird nun die Hausfrau, deren Arbeit nicht als Arbeit im eigentlichen Sinne, sondern als Liebe im uneigentlichen Sinne definiert ist, bevormundet von einer Armada männlicher Arbeitsköche im Hobby. Frauen dürfen dabei nur reinplappern und ausnahmsweise auch dick sein. Oder wie? Wir warten noch immer auf aussagekräftige statistische Erhebungen zur Veränderung des heimischen Eßverhaltens seit Clemens Wilmenrod und Kurt Drummer. Hier hatte es die letzten nennenswerten Einschnitte durch Krieg und später durch Kühltechnik gegeben.
Aus der Reihe Wunder der Nutzlosigkeit, der Eisschrank (um 1900): Ein dürftig wärmegedämmter Holzschrank mit zwei zumeist nebeneinanderliegenden Fächern, von welchen eines mit Speisen, das andere mit Frischeis und täglich befüllt wird; das Tauwasser fließt durch eine Rinne ab. Auch heute noch kann man gefrorenes Wasser kaufen, dann allerdings meist in kleinen Mengen im Einzelhandel, seltener per Kurier. Das Eis wurde z.B. in großen Scheiben aus der Arktis herausgeschnitten und so verschifft. Die Technik setzte sich nicht durch.
Großgeräte (Waschmaschine, Kühlschrank, Herd und der bis hierher völlig unerwähnte Geschirrspüler) sind also klassischerweise Frauensache (Kleingeräte auch), noch größere Geräte wie z.B. Mähdrescher wiederum meist nicht. Mit dieser Erkenntnis ist niemandem geholfen, das allerdings vor allem deshalb, weil es keine ist. Behandeln wir also noch den Geschirrspüler.
Die Person, die diesen benutzt, dreht an einer Kurbel, und die Teller schwurbeln in ihrem Gitter-Gatter oder Haltevorrichtung durch die Spüllauge, immer rein und raus. Das ganze erinnert äußerlich ein wenig an ein Gürteltier, zu sehen z.B. auf dem Cover des Buches »Haushaltsträume« (der Geschirrspüler, nicht das Gürteltier).
Es gibt keine prominenten Vorbilder für Frauen in der Küche – warum? Der scheinbare Widerspruch läßt sich in wenigen Sätzen auflösen, welche die ganze vorhergehende Abhandlung über Haushaltsgeräte obsolet machen. Zunächst einmal muß klar sein, daß Prominenz bedeutet, im Fernsehen zu sein; eine andere Definition gibt es nicht. Prominente Frauen, also Frauen im Fernsehen, sind natürlich alles Zeitenkinder. Fernsehen und Waschmaschine fallen historisch in dieselbe Ecke, nämlich die der Emanzipation, weshalb erst mal keine Frau Lust hatte, wenn sie denn ins Fernsehen durfte, dort zu kochen, also ein klassisches, althergebrachtes Frauenbild auszufüllen. So konnten sich hier keine Vorbilder etablieren, um dem heutigen Gesellschaftsteil »junges Mädchen« aus dem Klingeltonsiechtum zurück zu einer gesellschaftlich nutzvollen und damit lebenswerten Alltagsbeschäftigung zu verhelfen. Wer als Frau heute kocht, ist nur Schauspielerin. Genau wie es Clemens Wilmenrod übrigens auch war, nur ohne die weibliche Endung.
Inzwischen aber, wo nun eine Bedarfsbasis vorhanden wäre, sind so schöne technische Innovationen wie automatische Kochplatten weitgehend wieder verschwunden. Ein Temperaturfühler in der Mitte der Kochplatte wußte dabei immer genau, wann das Essen fertig war, und schaltete ab. Alternativ stellte man die Uhr. Vom britischen Werkarbeiter im 19. Jahrhundert noch Sinnbild arbeitgeberischer Unterdrückung und somit Objekt des Hasses, erwies sie sich hier nun endlich als nützlich.
Wahrscheinlicher ist allerdings, daß sich einfach niemand an die präzisen Befehle der Geräte hielt, sei es aus einer inneren Abwehr gegen das unbekannte Wesen oder schlicht aus Ignoranz und Besserwissertum, und daß dieser Zweig der Technik somit aus demselben Grund wieder aus den Haushalten verschwand, aus dem sich auch Weltuntergangssekten in der breiten Masse nie durchsetzten, nämlich das Nichteinhalten von Terminen. Dabei liegt der Fehler gar nicht im System, sondern im Menschen, der an dessen kognitiver Durchdringung scheitert. Nach einstimmiger Expertenmeinung wirkt sich auch in diesem Bereich die im Vergleich zum Mann um durchschnittlich 130g geringere Gehirnmasse der Frau nicht nachteilig aus.
Alle Spekulation wäre freilich hinfällig, würde die Technisierung schneller voranschreiten und von Science Fiction Dystopien geschürte mentale Blockaden aufgelöst, welche der Übernahme der Erde durch die Maschinen bislang noch im Wege stehen. Einen Geschlechterkampf gäbe es dann nicht mehr.
Dieser Artikel ist ALT. Er erschien zuletzt nicht im unveröffentlichten Lifestyle-Magazin »remède de la femme«.